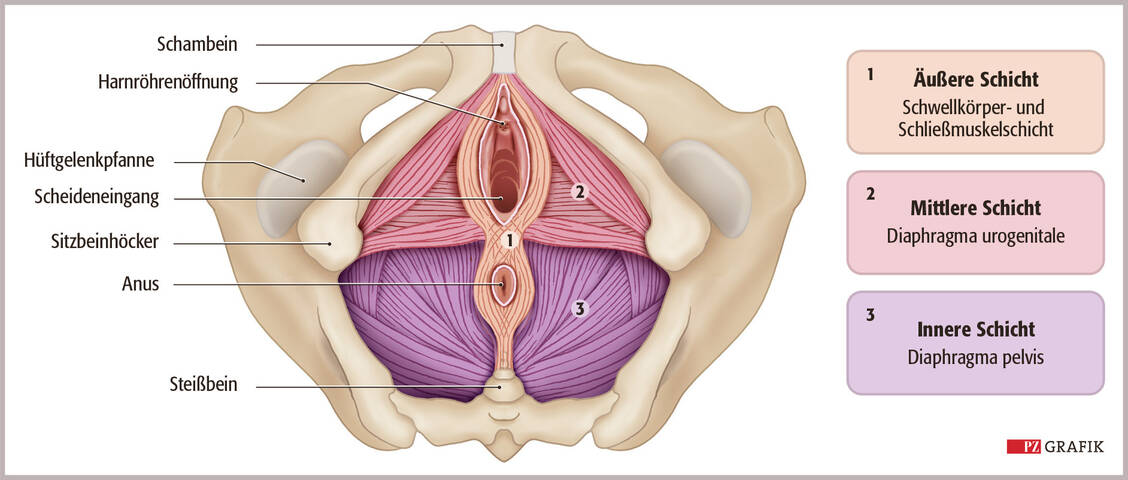Übersteigt der Druck in der Blase den Verschlussdruck des Beckenbodens, verlieren wir Urin (=Belastungs- oder Stressinkontinenz). Bei Husten hilft es, sich bewusst aufzurichten und zur Seite zu drehen, dabei die Ellenbogen nach hinten oben strecken und in die Ellenbeuge husten. Durch die Verdrehung im Oberkörper gewinnt der Rumpf an Stabilität und fängt Druck ab. Beim Anheben schwerer Gegenstände sollte man gleichzeitig mit der Belastung ausatmen. Hierdurch hebt sich der Beckenboden und der Druck nimmt ebenfalls ab.
Wird die Hose hingegen nur wenige Meter vor der Toilette nass, sprechen Mediziner von »Schlüsselloch-Inkontinenz«. Auch hierfür gibt es verschiedene Aufschubstrategien: Entweder so tun, als würde man ein Bonbon lutschen, oder aber sich bücken und beispielsweise den Schuh binden. Außerdem könne man der Blase gut zureden, es gemeinsam bis zur Toilette zu schaffen. Letzteres klingt zunächst albern, funktioniert aber. Klappt es nicht sofort, ist Geduld gefragt. Die Blase ist lernfähig.