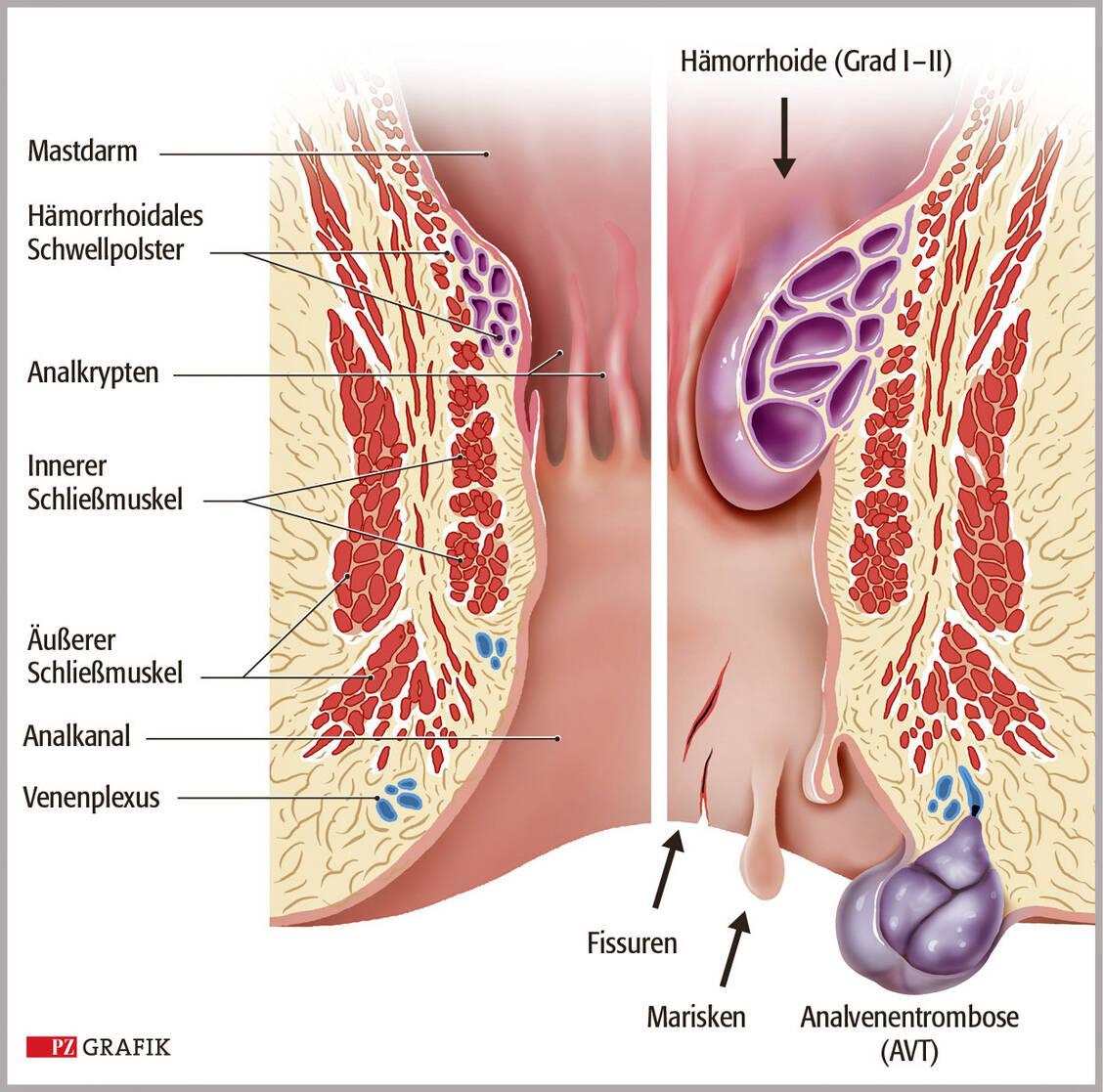Eine Windeldermatitis kann grundsätzlich jede Person betreffen, die Windeln trägt, ganz unabhängig vom Alter. Sie zählt in Deutschland zu den häufigsten dermatologischen Problemen bei Babys im Alter zwischen neun und zwölf Monaten. Bei älteren Menschen spricht man bei der Hautkrankheit eher von der Inkontinenz-assoziierten Dermatitis (IAD).
Kennzeichnend ist, dass die Haut im Bereich von Po, Genitalien und auf der Innenseite der Oberschenkel gerötet und aufgeweicht ist. Offene, nässende Stellen und Verkrustungen weisen auf eine sekundäre Infektion hin, bei der Candida albicans oder Staphylokokkus aureus häufig die Auslöser sind.
Verursacht werden die Hautirritationen durch das besondere Milieu im Inneren der Windel. Dieses beansprucht die Haut nicht nur mechanisch, sondern schafft auch einen Okklusionseffekt. Bakterien und Pilze finden im feucht-warmen Inneren der Windel optimale Wachstumsbedingungen vor und die geschundene Haut bietet leichte Eintrittspforten. Verschärft wird das Problem durch zu seltenes Windelwechseln, übertriebene Hygiene und ungeeignete Reinigungs- und Pflegemittel sowie Durchfall, saure oder scharfe Lebensmittel und bestimmte Medikamente wie Antibiotika.
Empfehlungen zur Prophylaxe und Therapie der Windeldermatitis werden oft mit dem Akronym ABCDE zusammengefasst:
- air (Luft),
- barriers (Barrieren),
- cleansing (Reinigung),
- diapers (Windeln) und
- education (Schulung).
Die Haut profitiert von windelfreien Zeiten, um an der Luft atmen und trocknen zu können. Ein regelmäßiger Windelwechsel, besonders nach dem Stuhlgang, ist wichtig, um die Haut nicht mehr als nötig zu reizen. Eine gründliche Reinigung mit handwarmem Wasser und milden Syndets sowie ein sanftes Trocknen der Haut sind ebenfalls wichtig.
Bei bereits vorhandenen wunden Stellen beschleunigt Zinkoxid die Heilung und bildet eine schützende Barriere vor weiteren Reizungen. Produkte mit Lanolin, wie Fett- oder Heilwolle, gelten als Geheimtipp bei geröteten Stellen. Gewaschene, aber ansonsten naturbelassene Schafwolle wird dazu in die frische Windel gelegt, um ein Luftpolster zu schaffen, das die Haut besser atmen lässt. Nicht zuletzt trägt die Wahl einer geeigneten, luftdurchlässigen Windel dazu bei, einen wunden Po zu vermeiden. In schweren Fällen oder bei Anzeichen einer Infektion hilft der (Kinder-)Arzt weiter.