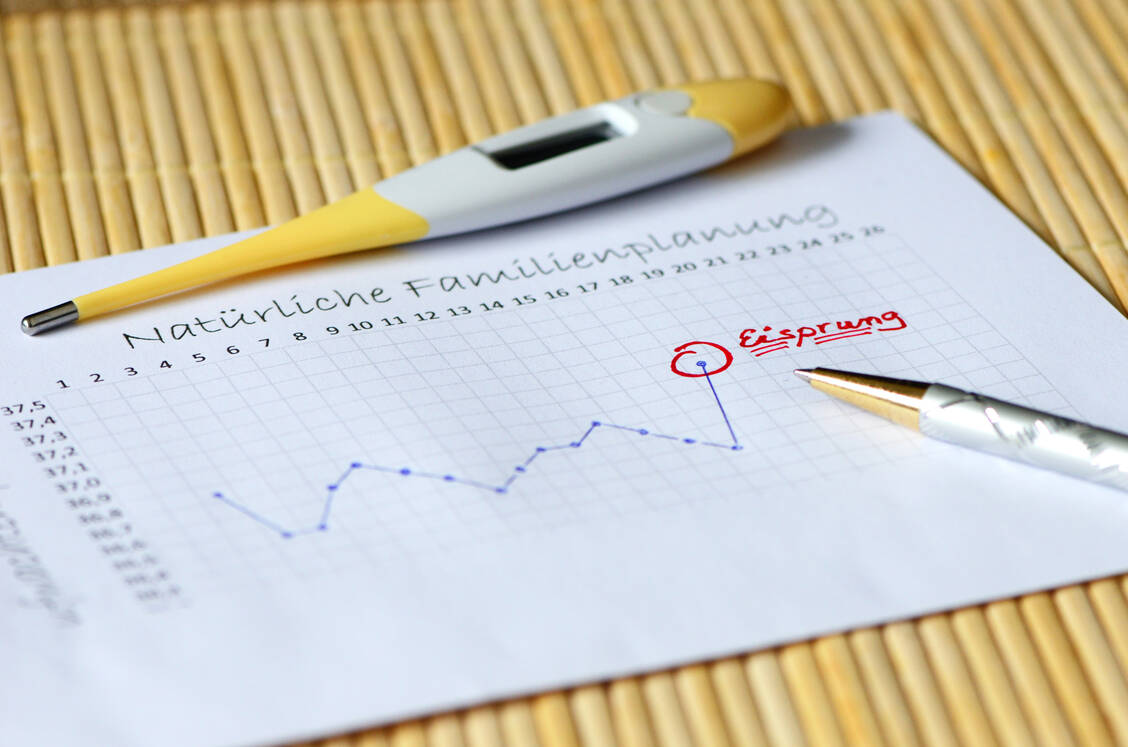Gerade für junge Frauen ist es wichtig, zu wissen, dass ihre Daten vertraulich behandelt werden. Bei Mädchen unter 14 Jahren wird allerdings bei der Abgabe die Zustimmung der Eltern empfohlen. In der »Pille danach« wird einer der beiden folgenden Wirkstoffe verwendet: Levonorgestrel, das bis 72 Stunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr wirksam ist, oder Ulipristalacetat mit einer Wirksamkeit von 120 Stunden danach. Wichtig ist der Hinweis, dass die Präparate eine bestehende Schwangerschaft nicht abbrechen.
Im Beratungsgespräch können PTA die Handlungsempfehlung der Bundesapothekerkammer nutzen. Bei Erbrechen innerhalb von drei Stunden nach der Einnahme wird eine zweite Dosis gegeben. Als Nebenwirkungen können Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und Müdigkeit auftreten. Die Blutung kann sich zudem verschieben. Bei mehr als sieben Tage ausbleibender Periode sollen die Frauen einen Arzt aufsuchen. Bei Geschlechtsverkehr nutzen sie für 14 Tage zusätzlich Barrieremethoden.