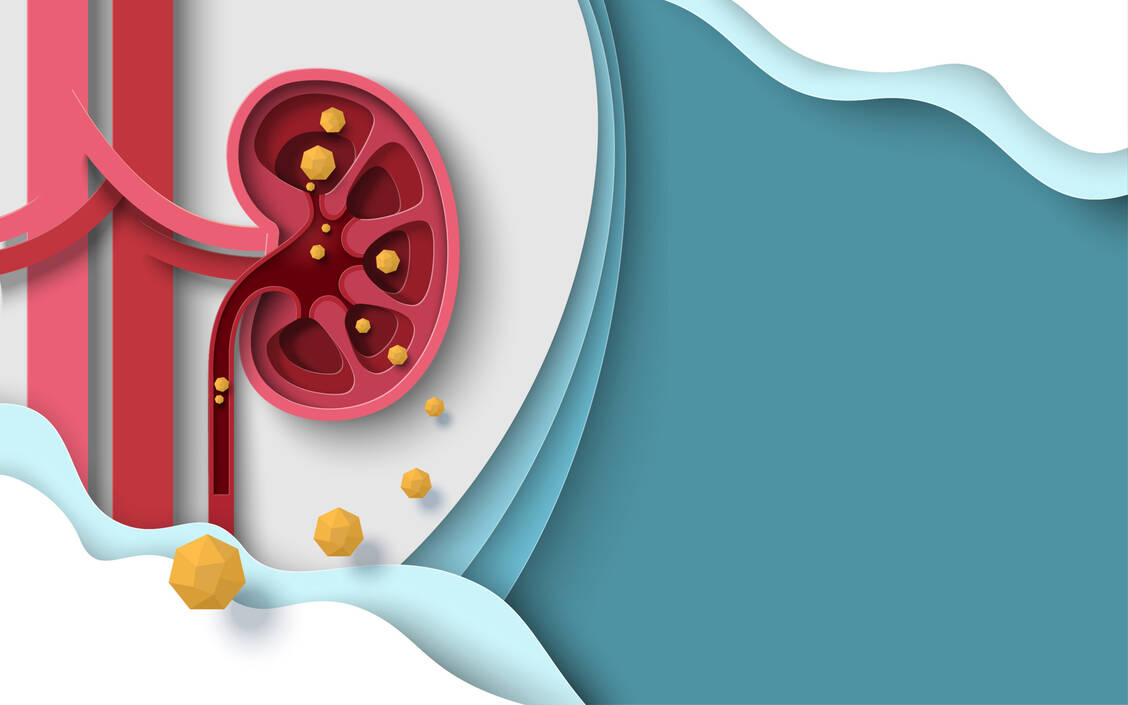Auch bei normaler Nierenfunktion kann es Situationen geben, die den Wasserhaushalt durcheinanderbringen. So können Patienten, die aufgrund einer Hypertonie oder Herzinsuffizienz ein Diuretikum einnehmen, unter Umständen dehydrieren. »Eine Diuretika-Therapie gehört zu den häufigsten Gründen, warum Patienten in der Notaufnahme vorstellig werden«, weiß Meyer. Durch die erhöhte Salz- und Wasserausscheidung über die Nieren kommt es zur Volumenreduktion, die das Herz entlastet. Wird jedoch etwa bei großer Hitze die Dosierung nicht angepasst oder die Medikation ausgesetzt, können Patienten, die nicht genug trinken, austrocknen. Hinzu kommt, dass oft auch Elektrolyte wie Kalium oder Magnesium mit verloren gehen und das Risiko für Herzrhythmus-Störungen steigt.