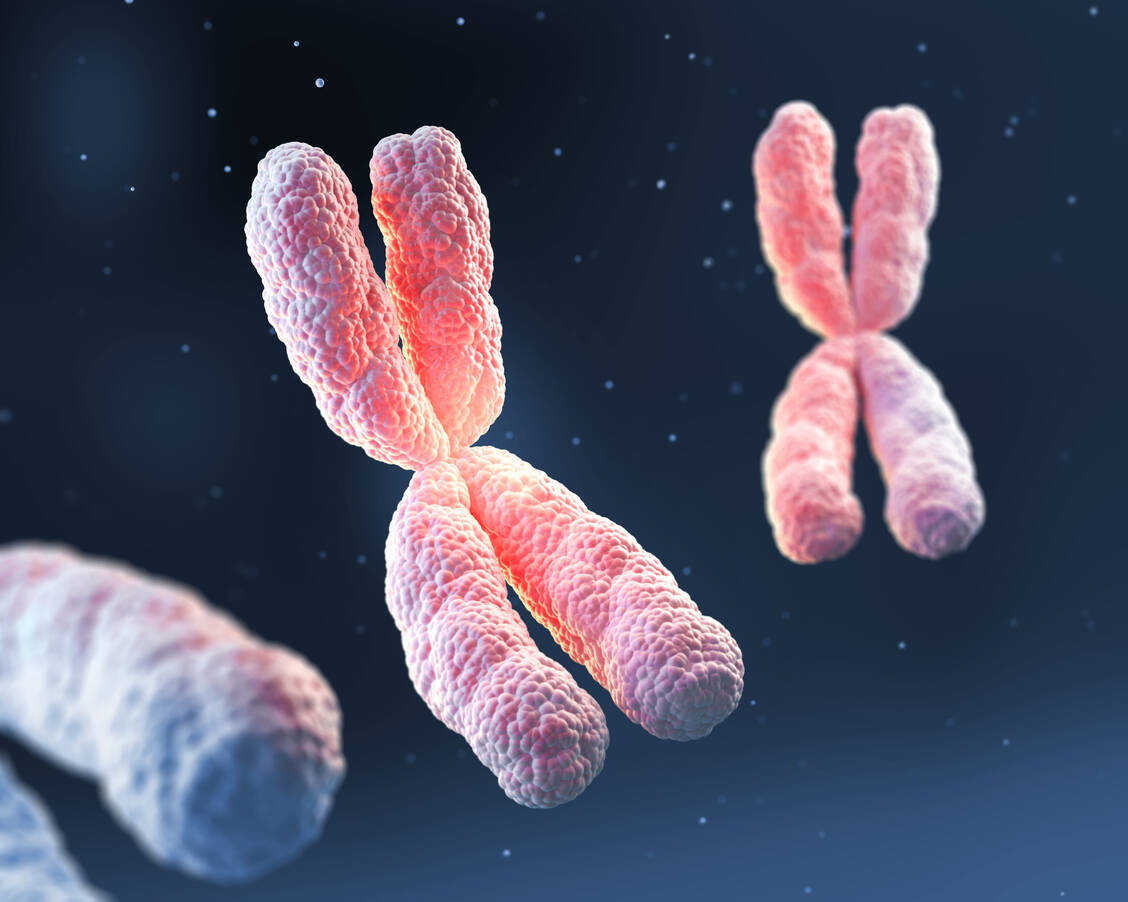Männer haben bekanntermaßen einen höheren Testosteronspiegel als Frauen. Sinkt dieser krankheitsbedingt, steigt das Risiko, an einer Autoimmunkrankheit wie Lupus erythematodes oder rheumatoide Arthritis zu erkranken. Eine mögliche Erklärung hierfür ist die immunsuppressive Wirkung, die von Testosteron ausgeht. Darüber hinaus sind Sexualhormone in der Lage, die Aktivität von Schlüsselgenen des Immunsystems zu beeinflussen. Eines davon ist das Gen AIRE (Autoimmun-Regulator). Es sorgt dafür, dass heranreifende T-Zellen nicht nur wichtige körpereigene Proteine kennenlernen und von Fremdproteinen unterscheiden können, sondern auch, dass T-Zellen, die körpereigene Proteine angreifen, umgehend vernichtet werden. Aus Untersuchungen mit Mäusen ist bekannt, dass Estrogen und Progesteron das AIRE-Gen hemmen und damit die Produktion des entsprechenden Proteins drosseln, während Testosteron sie ankurbelt. Von Menschen weiß man, dass Frauen weniger AIRE-Protein bilden als Männer.