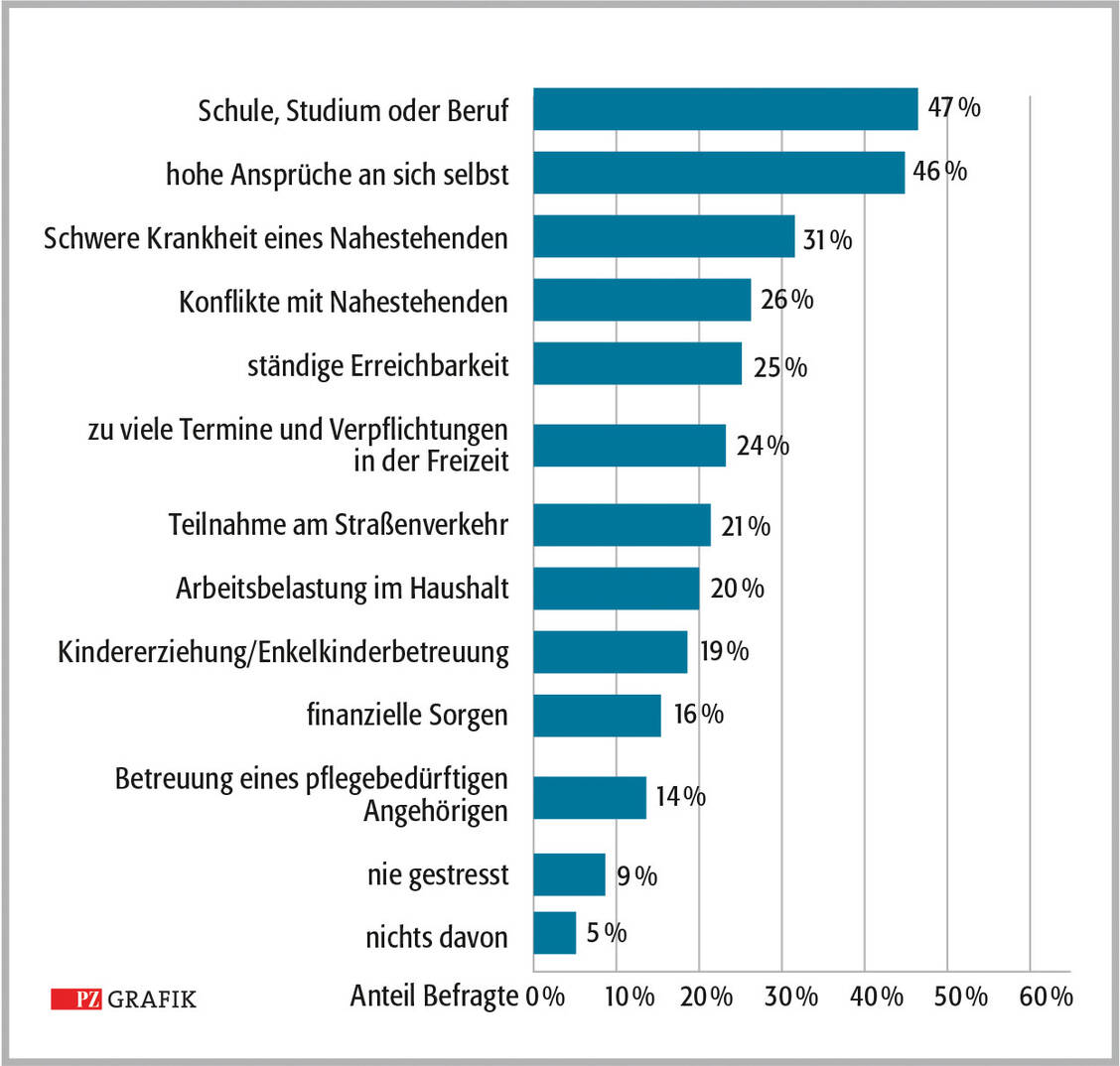Klavierunterricht, Tennis, Ballett, Kindergeburtstag, Kunst-AG und jeden Tag Hausaufgaben – manche Kinder haben einen Terminkalender, der mit dem eines Managers mithalten kann. Viele Termine müssen aber nicht unbedingt gleich Stress bedeuten, heißt es in einer Stellungnahme des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte: »Stress entsteht vor allem dann, wenn Termine mit Ängsten und Sorgen – etwa durch zu hohe Anforderungen – zu tun haben.« Bei Kindern sieht der Verband drei Quellen als Hauptursache für Stress:
- »Entwicklungsaufgaben« wie beispielsweise die Anpassung von der weitgehend unbeschwerten Zeit im Kindergarten an die Schule
- Einschneidende Lebensereignisse wie etwa eine Scheidung der Eltern oder der Tod einer geliebten Person
- Alltägliche Belastungen durch ständige Überforderung, beispielsweise in der Schule.
Symptome für Stress seien meist körperliche Beschwerden wie häufige Kopf- und Bauchschmerzen oder Einschlafstörungen. »Manche Kinder werden auch lust- und antriebslos, können sich nicht konzentrieren oder haben keinen Appetit«, so die Kinder- und Jugendärzte. Auch Verhaltensänderungen wie Rückzug, Aggressivität, Reizbarkeit oder Trennungsangst können Zeichen von Stress sein. Jüngere Kinder äußern Stress oft durch Wutausbrüche, Weinen oder vermehrte Anhänglichkeit, während ältere Kinder manchmal depressive oder ängstliche Symptome entwickeln. Bei starkem Stress fallen Kinder oft in frühere Entwicklungsstadien zurück. Beispielsweise können sie wieder anfangen, am Daumen zu lutschen oder Bettnässen zeigen.
Um Stresssituationen vorzubeugen, sollten Eltern ihren Kindern helfen, sich auf ihre Stärken zu besinnen. Dadurch kann das Kind lernen, mit Problemen umzugehen und sich von ihnen nicht so stark verunsichern zu lassen. Zudem sollte nicht jeder Tag verplant werden. Vielmehr brauchen Kinder mindestens zwei freie Nachmittage in der Woche, an denen sie sich an einen ruhigen Ort zurückziehen können, Zeit zum Spielen haben oder Verabredungen in Eigenregie treffen können.
Entscheidend ist auch die emotionale Unterstützung durch Bezugspersonen. Kinder, die in stressigen Situationen auf die Fürsorge und Zuwendung ihrer Eltern oder Betreuer zählen können, haben in der Regel eine bessere emotionale Resilienz. Auch beobachten Kinder, wie ihre Eltern und andere Erwachsene mit Stress umgehen. Eltern, die ruhig und strukturiert auf Stress reagieren und die mit ihren Kindern auch über Gefühle, Ängste und Sorgen sprechen, geben ihren Kindern bessere Bewältigungsstrategien mit. Schließlich profitieren Kinder von einer klaren Routine und Struktur im Alltag. Regelmäßige Mahlzeiten, Schlafzeiten und Aktivitäten geben ihnen oft ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit, was besonders in stressigen Zeiten wichtig ist.