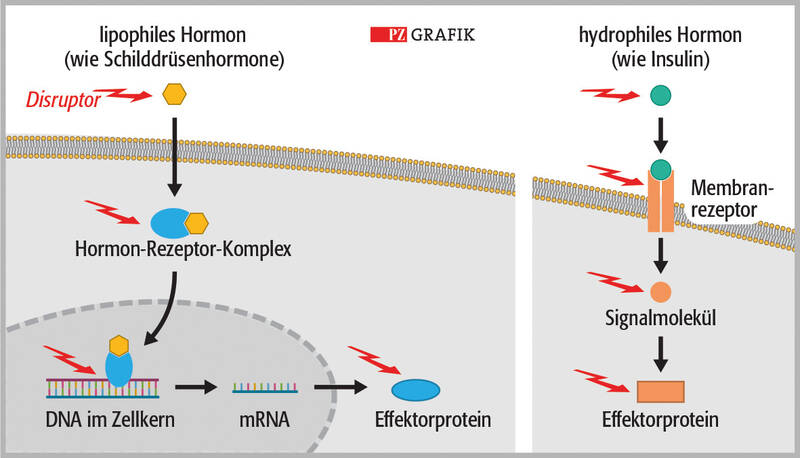In zurückgestellten Urinproben Hunderter Kita-Kinder und Erwachsener haben Behörden im Frühjahr vermehrt ein Stoffwechselabbauprodukt von Weichmachern namens Mono-n-hexylphthalat (MnHexP) nachgewiesen. Zuerst wurde das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen fündig, dann das Umweltbundesamt bei der vorläufigen Daten-auswertung der Deutschen Umweltstudie.
Das Kritische daran: MnHexP ist ein Metabolit von Di-n-hexylphthalat (DnHexP), ein Weichmacher, der in der EU schon vor Jahren als »besonders besorgniserregend« eingestuft und seit 2019 als Inhaltsstoff in Lebensmittelkontaktmaterialien, Spielzeug und kosmetischen Zubereitungen verboten wurde. Die Suche nach den Ursachen für die erhöhten Werte in den Urinproben läuft, bislang gibt es nur Mutmaßungen. Als eine mögliche Quelle stehen Sonnenschutzmitteln im Visier, auch weil die Urinproben aus den Sommermonaten auffällig erhöht waren.
Für Köhrle erklärt »diese Sonnenschutzmittel-Ursprungs-Hypothese nicht alles. Es muss noch mehr Quellen geben. Ich mag an dieser Stelle etwas provokativ sein, aber die Chemiefirmen, die die Ausgangssubstanzen liefern, haben es über all die Jahrzehnte geschafft, gesundheitsgefährdende Substanzen in der Produktion zu halten, obwohl es gute Daten gibt, dass man auf diese Chemikalien nicht angewiesen ist. Der Lobbydruck der Hersteller auf die regulatorischen Behörden ist da sehr groß. Wir brauchen in der EU eine Chemikalienpolitik, die den vorsorgenden Gesundheitsschutz vor den Profit stellt«.