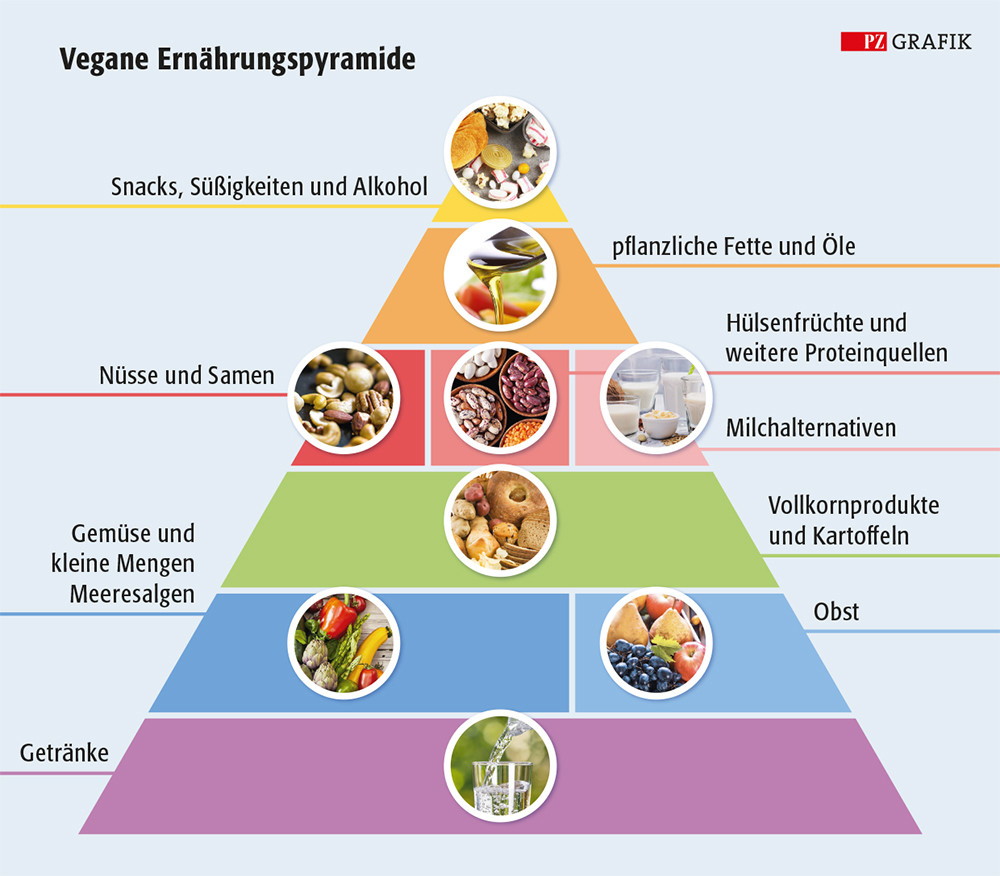Veganer sind in der Regel gut mit Beta-Carotin, Vitamin E, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin C, Kalium und Magnesium versorgt. Auch die Zufuhr von sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen liegt deutlich höher als bei Menschen, die Mischkost bevorzugen. Dennoch gibt es einige Nährstoffe, die in veganen Speiseplänen zu kurz kommen können. Das bedeutet, dass die Aufnahme häufiger unter der empfohlenen Zufuhr liegt. Zu den potenziell kritischen Nährstoffen zählen Proteine, Vitamin B12, Calcium, Eisen, Zink, Vitamin B2, Selen, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) sowie die auch in der Allgemeinbevölkerung kritischen Nährstoffe Jod und Vitamin D. Die Zufuhr ist deshalb oft niedriger, weil pflanzliche Lebensmittel im Durchschnitt weniger dieser Nährstoffe enthalten als tierische. Hinzu kommt, dass einige Nährstoffe aus pflanzlicher Kost schlechter bioverfügbar sind als aus tierischen Quellen. Hemmend auf die Verwertbarkeit wirken beispielsweise Phytinsäure (in allen Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen) oder Oxalsäure, die in Rhabarber, Mangold oder Spinat steckt, da beide Mineralstoffe wie Zink, Eisen oder Calcium binden und so dem Körper teilweise vorenthalten.