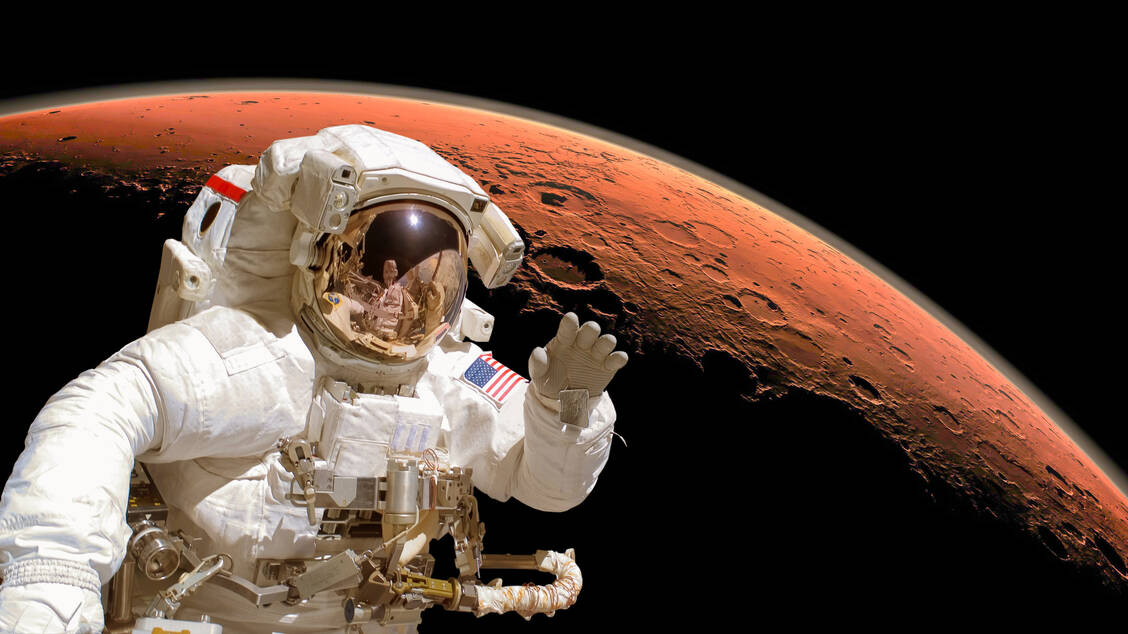Bei Apollo 7 verzichtete man zunächst auf das empfohlene Nasenspray mit Oxymetazolin, mit beinahe fatalen Folgen. Die Crew bekam eine Erkältung, und die Männer litten so sehr unter ihren verstopften Nasen, dass sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre die Helme ihrer Raumanzüge nicht schließen konnten. Seither ist das Rhinologikum fester Bestandteil aller Bordapotheken und flog auch mit zum Mond.
Die Nasentropfen von Apollo waren eine echte Marktneuheit der 1960er-Jahre, weil sie den in Deutschland entwickelten Wirkstoff Oxymetazolin enthielten. Die NASA war aufgrund seiner verlässlichen Wirksamkeit und guten Verträglichkeit schnell darauf aufmerksam geworden. Dies wirkt bis heute nach: Die Angaben zur Wirkdauer in Monografien und Literatur stammen tatsächlich nicht aus irdischen klinischen Versuchen, sondern aus den Erkenntnissen der Anwendung im Weltraum.