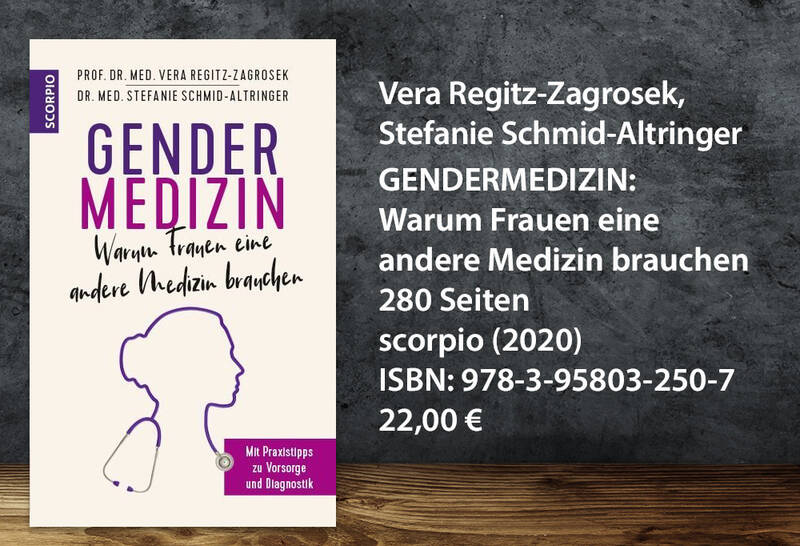Vielen Frauen bereitet es Probleme, für sich selbst einzustehen, wenn es um die Gesundheit geht. Das zeigt etwa eine Untersuchung von Regitz-Zagrosek und Kollegen, in der Männern und Frauen erklärt wurde, was gesundheitsbewusstes Verhalten ausmacht und welche Risiken (Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen) sich beeinflussen lassen. Anhand eines Fallbeispiels sollten die Probanden dann bewerten, wie gut der Mensch auf seine Gesundheit achtet. Männer wie Frauen schätzten das relativ richtig ein. Im Anschluss sollten die Probanden ihr eigenes Risiko auf Grundlage ihres Lebensstils bewerten.
Hier unterschätzten die Frauen ihr individuelles Risiko massiv, wohingegen die Männer bei sich selbst weitgehend richtiglagen. Das Risiko ihrer Partner ordneten Frauen wiederum realistisch ein. Frauen brauchen mehr Selbstfürsorge, schließt die Expertin aus dieser Untersuchung. PTA und Apotheker können dazu tagtäglich einen wertvollen Beitrag leisten.