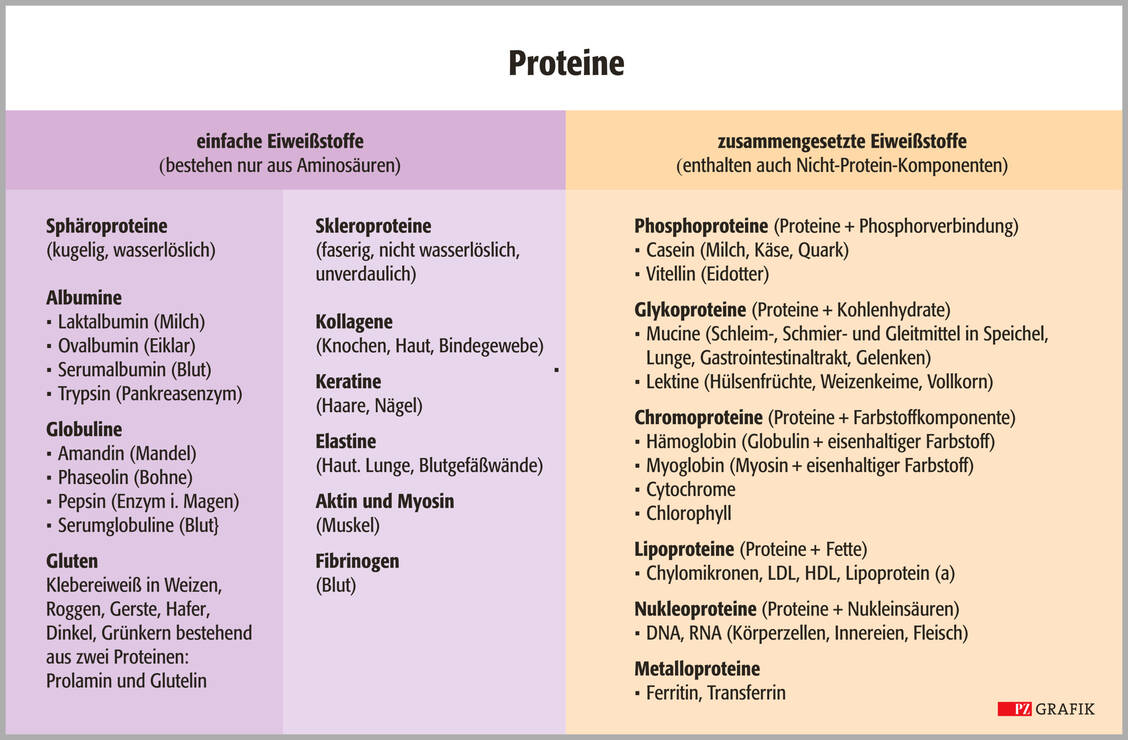Nur 20 Aminosäuren sind Bausteine aller menschlichen Proteine. Sie werden proteinogen genannt, liegen wie alle in natürlichen Proteinen vorkommenden Aminosäuren in L-Konfiguration vor und können mit einem Drei- oder Einbuchstabencode abgekürzt werden. 9 der 20 sind unentbehrlich, müssen also mit der Nahrung aufgenommen werden. Die Übrigen kann der Körper in aller Regel selbst herstellen. Semi-essenzielle Aminosäuren, unter anderem Arginin, Histidin, Cystein oder Tyrosin, müssen aber in bestimmten Situationen, wie gesteigertem Proteinbedarf in Schwangerschaft, Wachstum und Rekonvaleszenz oder bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen, mit der Nahrung aufgenommen werden.