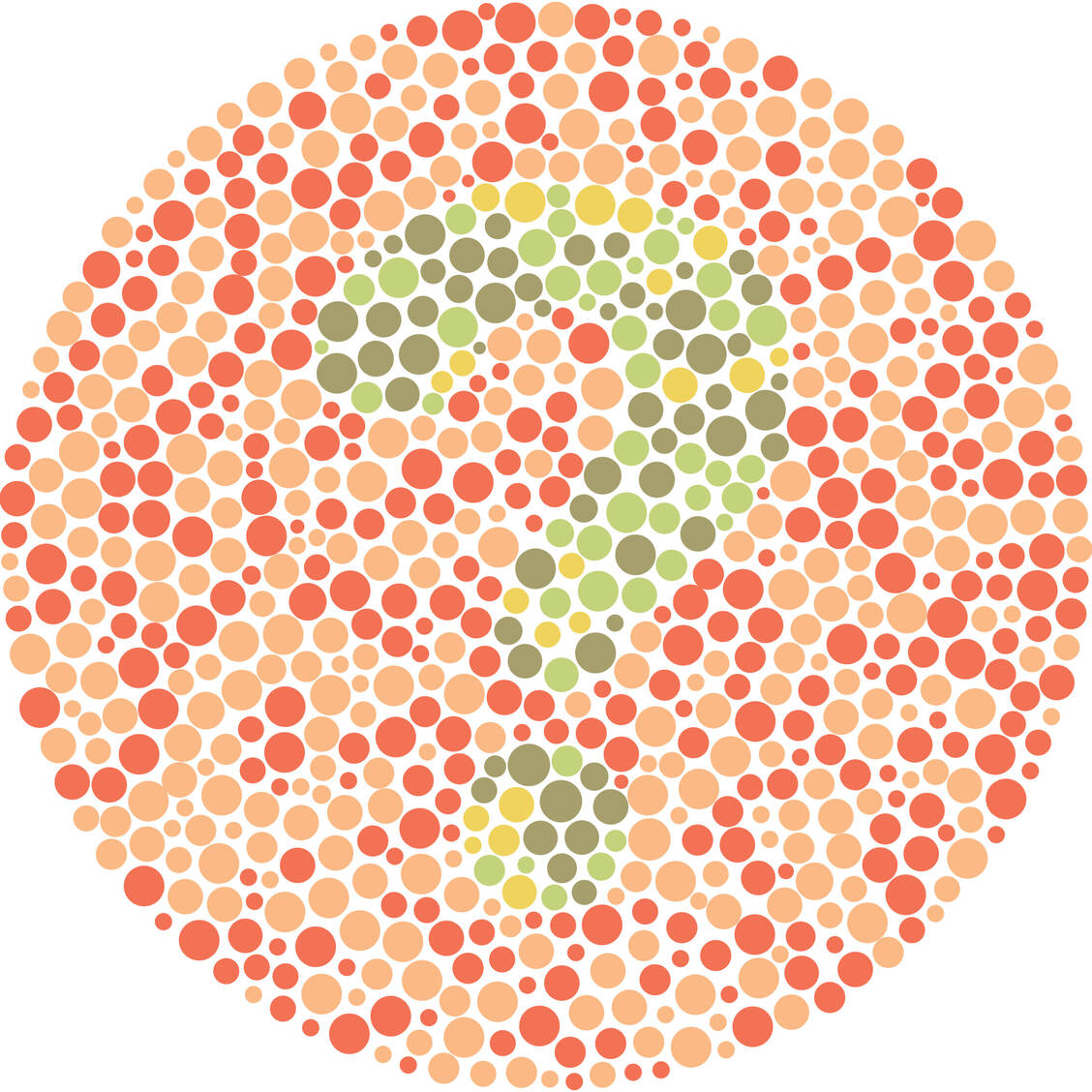Neben Farben können normalsichtige Menschen mehrere Millionen Farbnuancen unterscheiden. Das hilft bei der Auswahl der Kleidung, dem Einrichten der Wohnung oder dem Betrachten eines Gemäldes. Wesentlich bedeutsamer ist eine fehlerfreie Farbwahrnehmung jedoch, wenn Farben eine Signalfunktion zukommt sowie für die sogenannte Figur-Grund-Unterscheidung. Diese ermöglicht es, verschiedene Objekte voneinander zu unterscheiden und Gegenstände, die sich teilweise überdecken, auseinanderzuhalten. Farben liefern den dafür notwendigen Kontrast und weisen darauf hin, dass Teile eines Gegenstandes, die durch ein davorstehendes Objekt getrennt werden, in Wirklichkeit zusammengehören. Dies bewahrt uns auch vor inkorrektem Sehen durch Schatten oder Spiegelungen.