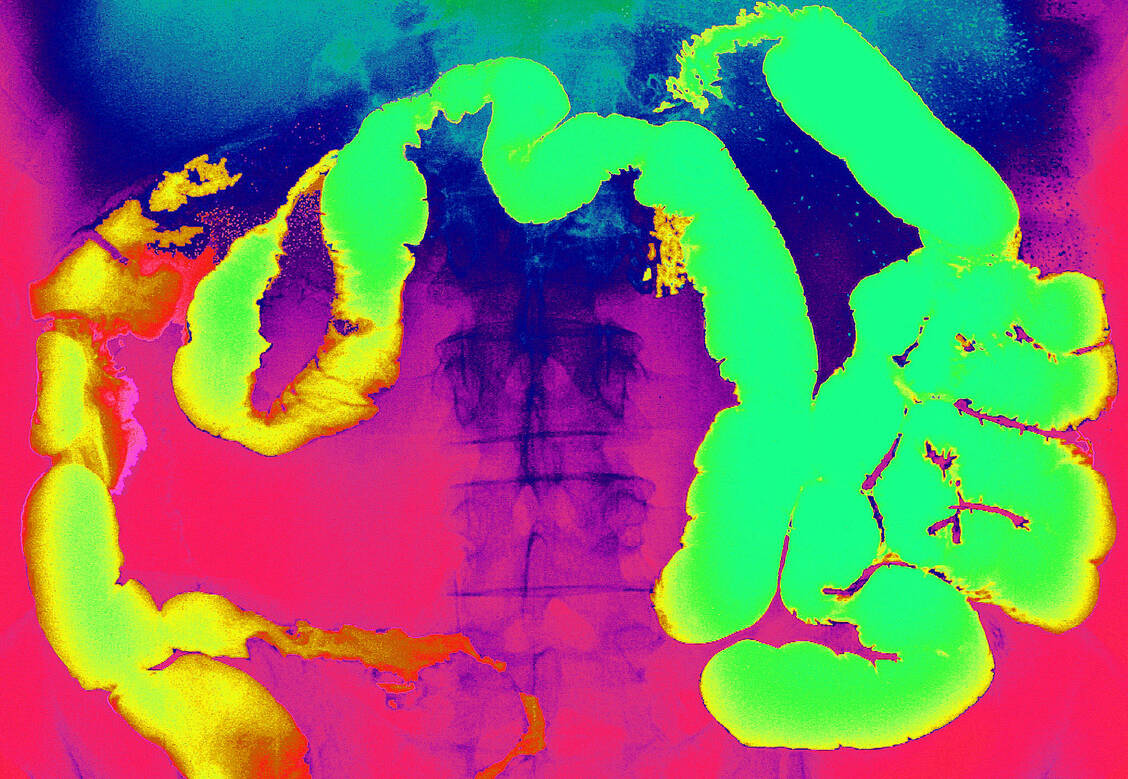Außerdem ist die Bakterienvielfalt gegenüber Gesunden reduziert. Das gilt etwa für die Buttersäurebildner wie das entzündungshemmende Faecalibacterium prausnitzii, deren Anzahl im Schub noch stärker vermindert ist als in Remission. Buttersäure jedoch ist unverzichtbar für Aufbau und Differenzierung der Darmschleimhautzellen, dient ihnen als Energiequelle und stärkt die tight junctions, also die Verbindungsstellen zwischen den Zellen. Ausreichend Buttersäure scheint auch einem Leaky-Gut-Syndrom, also dem Syndrom des durchlässigen Darms, vorbeugen zu können. Weil eine ballastreiche Ernährung zu einer erhöhten Buttersäureproduktion beiträgt, gilt sie für CED-Patienten besonders sinnvoll. Doch Vorsicht: Wenn es im Verlauf eines Morbus Crohn zu Stenosen im terminalen Ileum kommt, muss der Kranke auf ballaststoff- und faserreiche Lebensmittel verzichten.