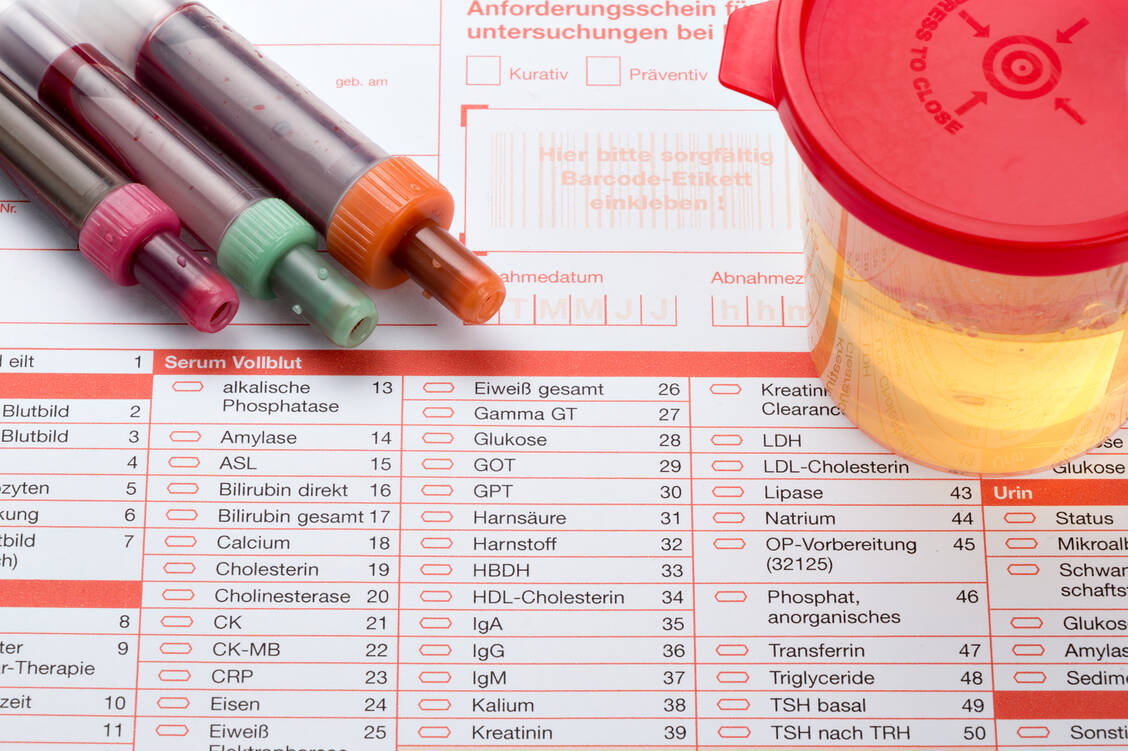Statistisch betrachtet erkrankt jeder zweite Mensch im Laufe seines Lebens an Krebs. In den meisten Fällen gilt: Je früher die Erkrankung entdeckt wurde, umso besser ist sie zu behandeln. Doch zuverlässige Früherkennungsuntersuchungen gibt es derzeit nur für wenige Krebsarten. Brust-, Darm-, Haut-, Gebärmutterhals- und Prostatakrebs zählen dazu, in Deutschland sind kostenlose Screeningprogramme für alle gesetzlich Versicherten ab bestimmten Altersgrenzen etabliert. Bei vielen anderen Krebsarten ist es jedoch in der Mehrheit der Fälle so, dass sie erst entdeckt werden, wenn sie Beschwerden verursachen.
Für die Betroffenen ein Schock, insbesondere, wenn sie regelmäßig alle empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen.