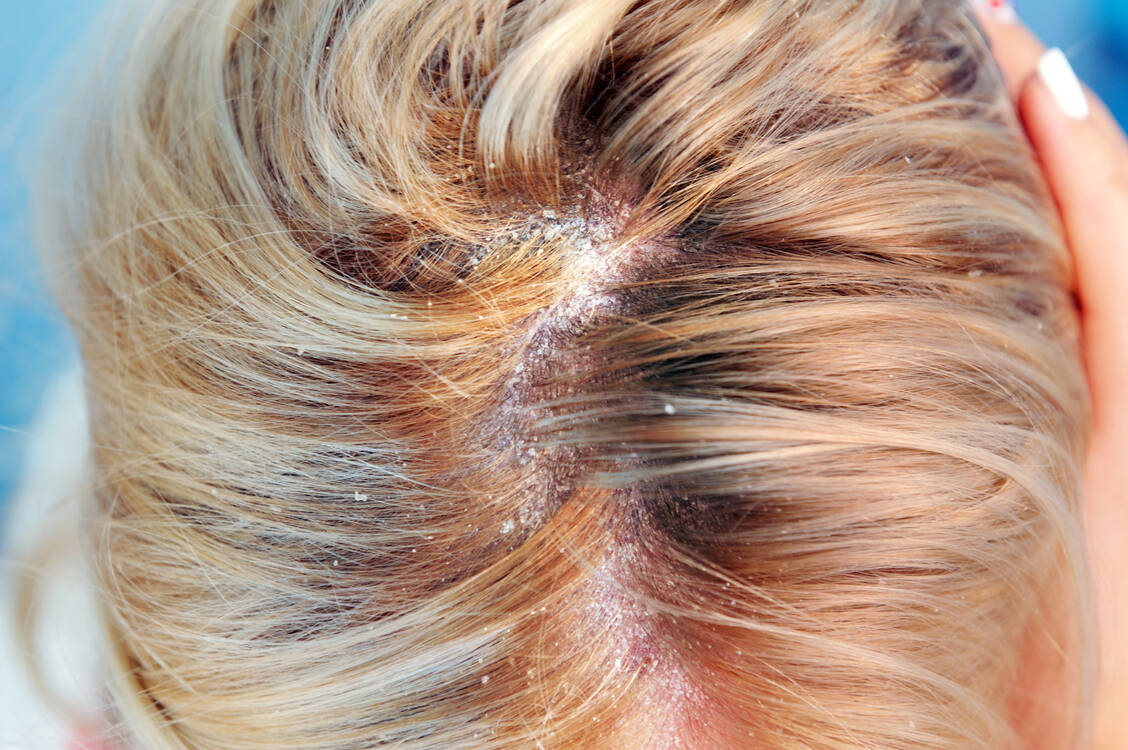Wer aufgrund seines Berufs häufig flüssigkeitsdichte Handschuhe tragen muss – etwa im Gesundheitswesen oder in Reinigungsunternehmen –, ist anfälliger für Pilzansiedlungen in den Fingerzwischenräumen, Tinea interdigitalis genannt. Auch in Hautfalten, beispielsweise unter der Brust, in den Achselhöhlen oder im Analbereich, siedeln sich gerne Pilze an (Tinea intertriginosa). Typischerweise sind die befallenen Hautstellen rot und schuppig und zeigen einen erhabenen Randsaum. Sie können jucken und brennen, manchmal sogar schmerzen. Stark übergewichtige Personen sind besonders gefährdet. Diabetes begünstigt Pilzerkrankungen ebenfalls. Der Grund: Dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte beeinträchtigen das Immunsystem, zudem haben Patienten oft eine trockene, rissige Haut und schlecht heilende Wunden.