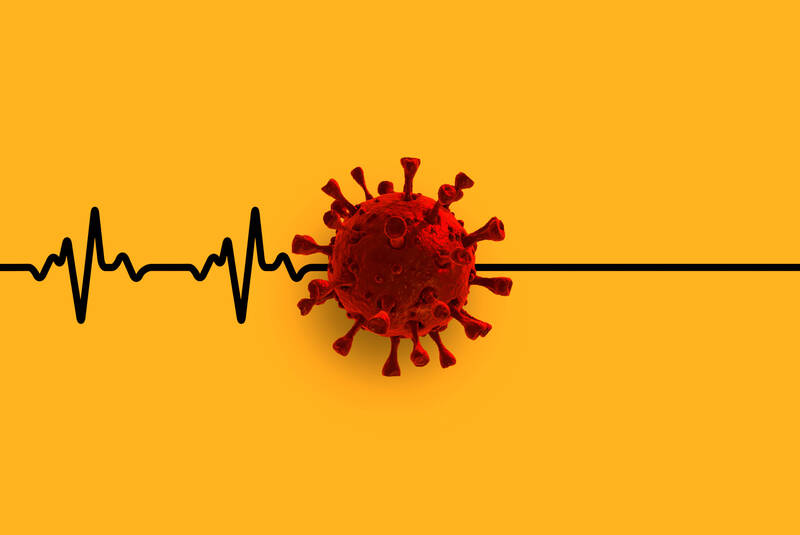Das Coronavirus scheint häufiger als andere Viren eine Myokarditis auszulösen. Bis zu 30 Prozent der schwer erkrankten Patienten leiden nach einer Covid-19-Erkrankung unter anhaltenden Beschwerden und Funktionseinschränkungen des Herzens. Eine Studie konnte beispielsweise zeigen, dass eine Herzmuskelentzündung nach einer Coronainfektion fast dreimal häufiger auftrat als nach einer Infektion mit Influenzaviren. Wie genau SARS-CoV-2 das Herz schädigt, ist bislang allerdings noch nicht gänzlich geklärt.
Untersuchungsdaten erhärten inzwischen den Verdacht, dass das Coronavirus Schäden direkt am Herzen verursachen kann. Es nutzt unter anderem das Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) zum Eintritt in Gewebe des Nasen-Rachen-Raums. Auch im Herzen findet sich ACE2 – was zumindest teilweise die erhöhte Anfälligkeit für Herzmuskelentzündungen erklären könnte.
Auch bei einem milden Verlauf erhöht Covid-19 das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen langfristig. Das zeigt eine 2022 in »Nature Medicine« veröffentlichte Studie. Dafür hatten die Autoren Gesundheitsdaten von mehr als 150.000 US-Veteranen ausgewertet, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert hatten. Sie hatten bis zu zwölf Monate nach der Infektion im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, darunter zerebrovaskuläre Störungen, Herzrhythmusstörungen, ischämische und nicht ischämische Herzerkrankungen, Perikarditis, Myokarditis, Herzinsuffizienz und thromboembolische Erkrankungen.