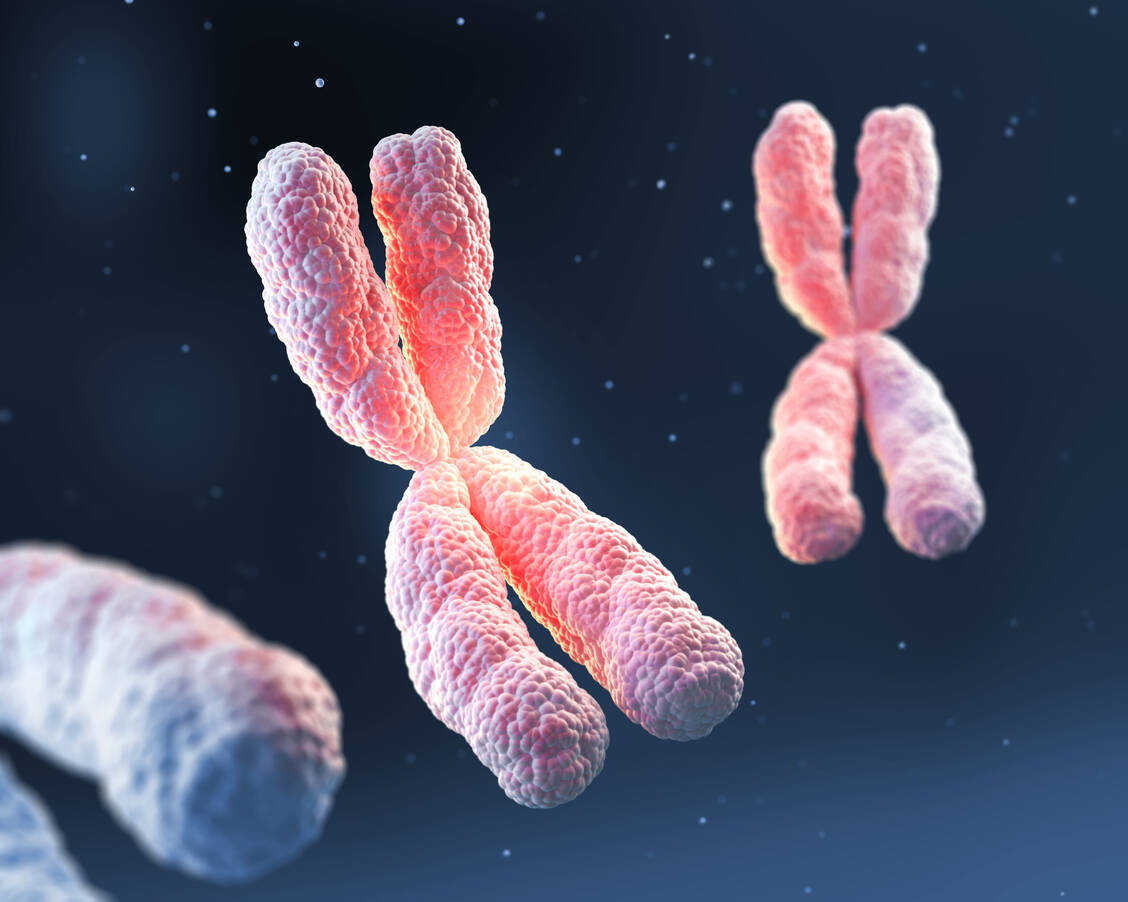Lupus erythematodes, das Sjögren-Syndrom, Hashimoto-Thyreoiditis oder die systemische Sklerose zählen zu den Autoimmunerkrankungen, die überwiegend Frauen betreffen. Alle brechen besonders häufig in einer der drei großen weiblichen hormonellen Veränderungsphasen – Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre – aus. Schon lange stehen deshalb Sexualhormone unter Verdacht, zu den entscheidenden Einflussfaktoren der ungleichen Geschlechterverteilung zu zählen. Bekannt ist etwa, dass Estrogen B-Zellen des Immunsystems aktiviert, Antikörper oder im Fall einer Autoimmunkrankheit Autoantikörper zu produzieren. Zur Erinnerung: Antikörper heften sich an bestimmte Moleküle (Antigene) körperfremder Strukturen wie Bakterien oder Viren, die dadurch von anderen Zellen erkannt und vernichtet werden. Autoantikörper binden fälschlicherweise an Strukturen auf den eigenen Körperzellen, die anschließend ausgeschaltet werden.