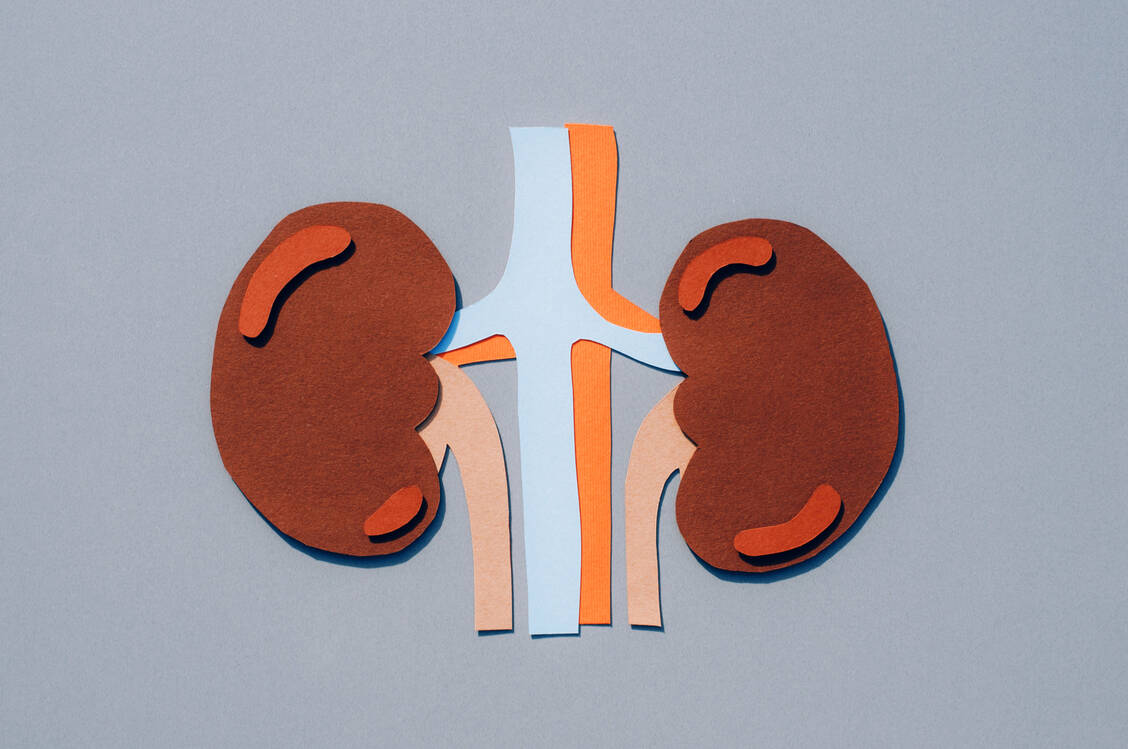Die gute Nachricht: »Mit einer Umstellung der Essgewohnheiten kann das Fortschreiten der Niereninsuffizienz verlangsamt und damit wiederum das kardiovaskuläre Risiko reduziert werden«, so Fleig. Wie so oft steht das Darmmikrobiom im Fokus. »Was wir essen, ist das Substrat für die Bakterien und steuert, welche Populationen sich vermehren können.« Vor allem Ballaststoffe sind wichtig, da sie nützlichen Darmbakterien als »Futter« dienen. Diese stellen daraus kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat, Propionat und Acetat her – »Energielieferanten für die Zellen unserer Darmwand, wir können sie nicht selbst herstellen.«