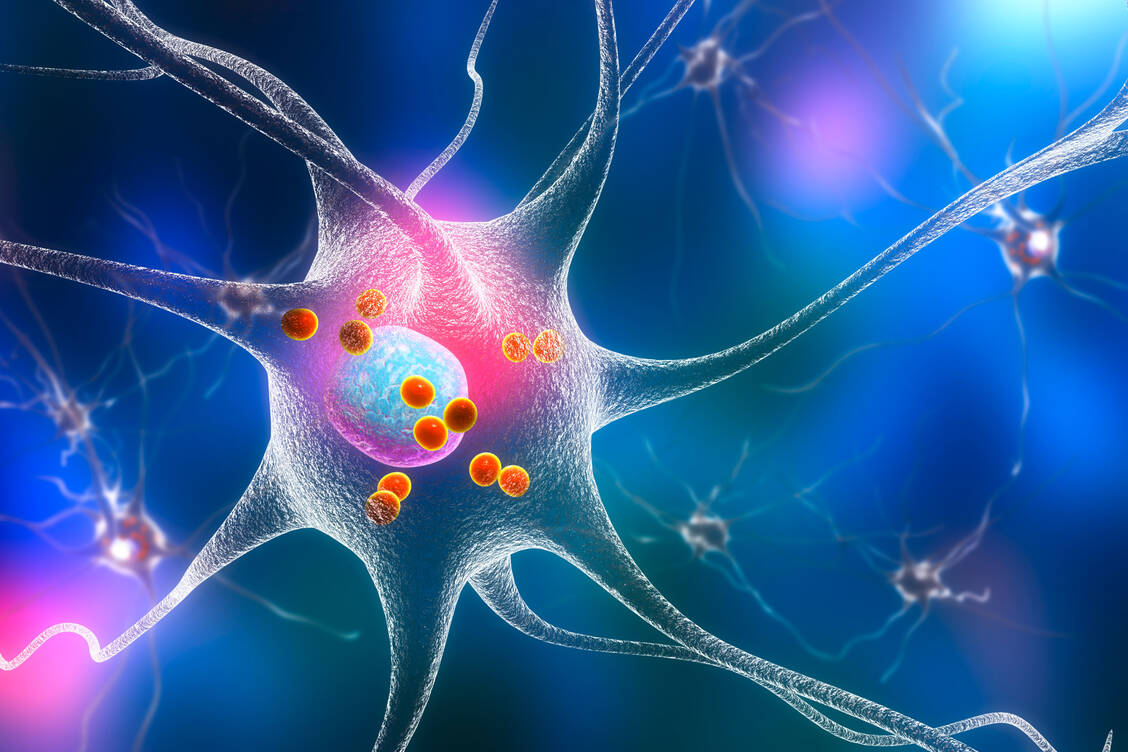Morbus Parkinson tritt eher in höheren Lebensjahren, bei Menschen jenseits des 50. Lebensjahres auf, nur sehr selten wird die Erstdiagnose vor dem 40. Lebensjahr gestellt. Ist die Ursache der Erkrankung nicht bekannt – wie in den meisten Fällen – , sprechen Mediziner vom idiopathischen Parkinson Syndrom (IPS). Diese Parkinsonform muss von sekundären Parkinsonkrankheiten abgegrenzt werden, die zum Beispiel durch Hirnschädigungen oder Medikamente ausgelöst werden. Beim IPS spielt die genetische Disposition eher eine untergeordnete Rolle, während wohl Lebensstil und äußere Faktoren die Krankheitsentstehung begünstigen sollen.