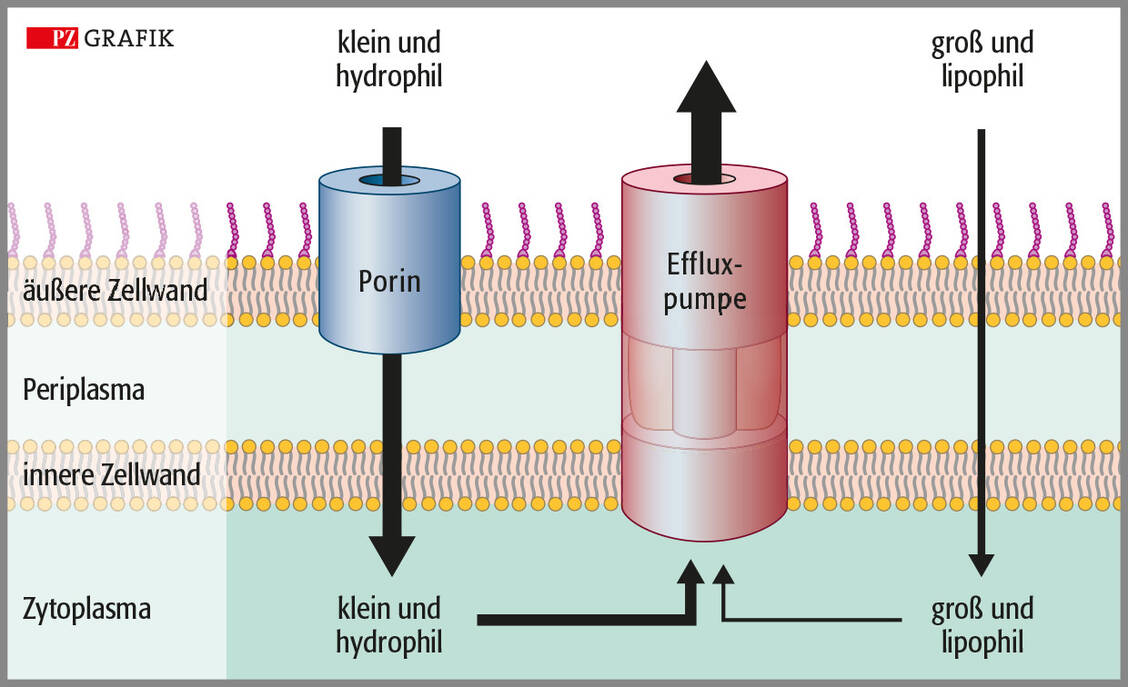Das birgt für die Industrie gleich mehrere Probleme, wie Holzgrabe schildert: »Die Entwicklung eines neuen Antibiotikums kostet etwa eine Milliarde Euro.« Demgegenüber steht ein äußerst magerer finanzieller Anreiz. Ohne Bescheinigung eines beträchtlichen Zusatznutzens droht sogar ein finanzielles Fiasko, denn dann wird der Arzneistoff in eine Festbetragsgruppe eingruppiert. Letzteres führte oft dazu, dass Wirkstoffe in Deutschland gar nicht auf den Markt kamen. Doch selbst mit einem sensationell wirksamen, neu entwickelten Mittel dürften nur sehr wenige Patienten behandelt werden, um eine zu schnelle Resistenzbildung zu verhindern. Eigentlich wolle Holzgrabe die Pharmafirmen nicht in Schutz nehmen. »Doch wenn es für den Notfall in der Schublade liegt, was soll die Industrie daran verdienen?« Firmen wie Bayer, Sanofi und Novartis haben die Antibiotika-Forschung längst aufgegeben.