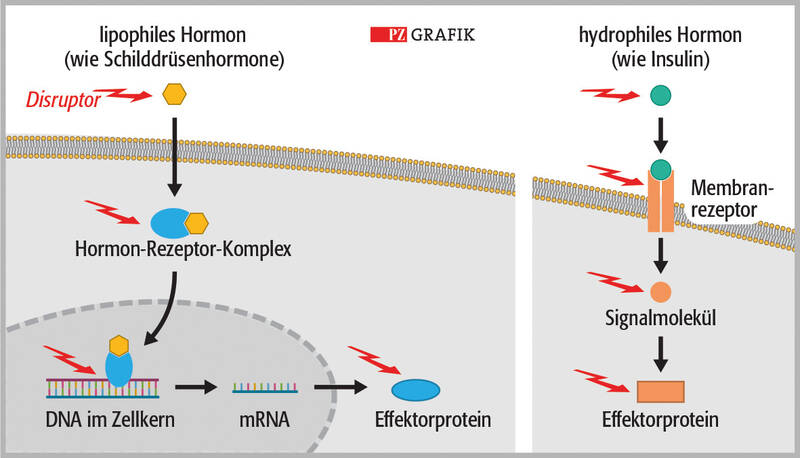Phthalate, Phenole, Dioxine, Parabene, Pestizide, per- oder polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS): Die Liste dieser künstlich erzeugten Substanzen ist lang. Sie stecken als Weichmacher in Kunststoffverpackungen, verhindern das Anhaften des Spiegeleis in der Pfanne, imprägnieren die Oberflächen von Textilien und Möbeln, sorgen für leichte Verteilbarkeit der Bodylotion auf der Haut oder verhindern das Durchsickern des Kaffees durch den To-go-Becher. Sie finden auch in Feuerlöschschäumen, in der Medizintechnik etwa bei Dialyseschläuchen oder Herzklappen, in der Luftfahrt und dem Autobau Verwendung.