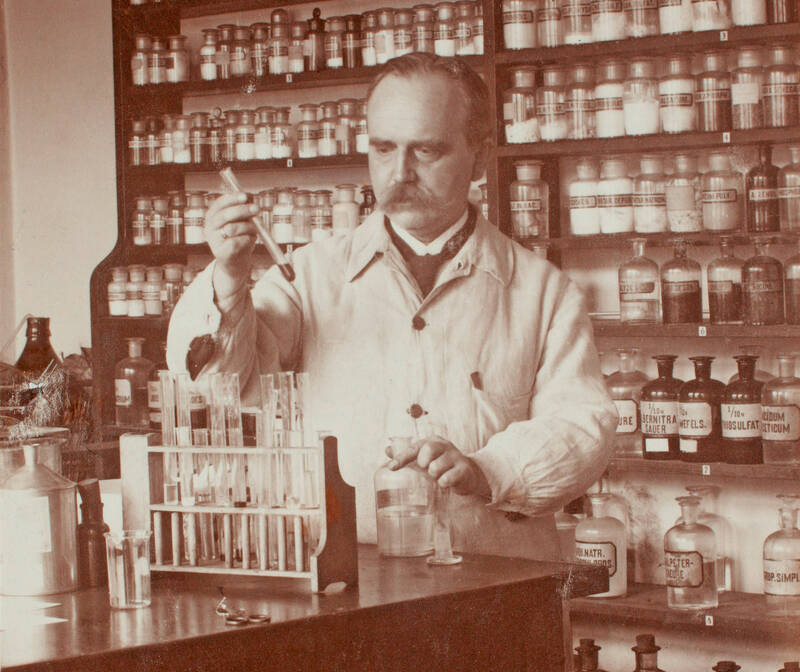Noch einen Schritt weiter gingen Wissenschaftler des Rensselaer Polytechnic Institute aus Troy, New York. Ihre »Tinte« enthielt zusätzlich Endothelzellen, welche das Innere von Blutgefäßen bilden, und Perizyten, welche an der Außenwand von Blutkapillaren zu finden sind. Damit soll sichergestellt werden, dass die neue Haut ausreichend viele Blutgefäße bildet. Bis wann Patienten von 3D-Verfahren profitieren, lässt sich derzeit aber nicht sagen.
Ärzte des Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikums Bergmannsheil haben die Praxistauglichkeit eines anderen Verfahrens längst belegt. Sie isolierten Stammzellen aus der Haut und veränderten im Labor ein Gen. Dies war erforderlich, weil ihr Patient nicht an Verletzungen, sondern an einer erblichen Hautkrankheit, der Epidermolysis bullosa, litt. Die Haut ist bei betroffenen »Schmetterlingskindern« so empfindlich wie ein Flügel des namensgebenden Insekts. Demensprechend schnell treten Verletzungen auf. Die Stammzellen wuchsen im Labor zu Hautlappen heran und wurden dann übertragen: ein Verfahren, das sich bei Patienten mit stark zerstörter Haut ohne Erbkrankheit ebenfalls eignet, wie die Wissenschaftler belegen konnten.