
Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH
Checkpoint-Inhibitoren |
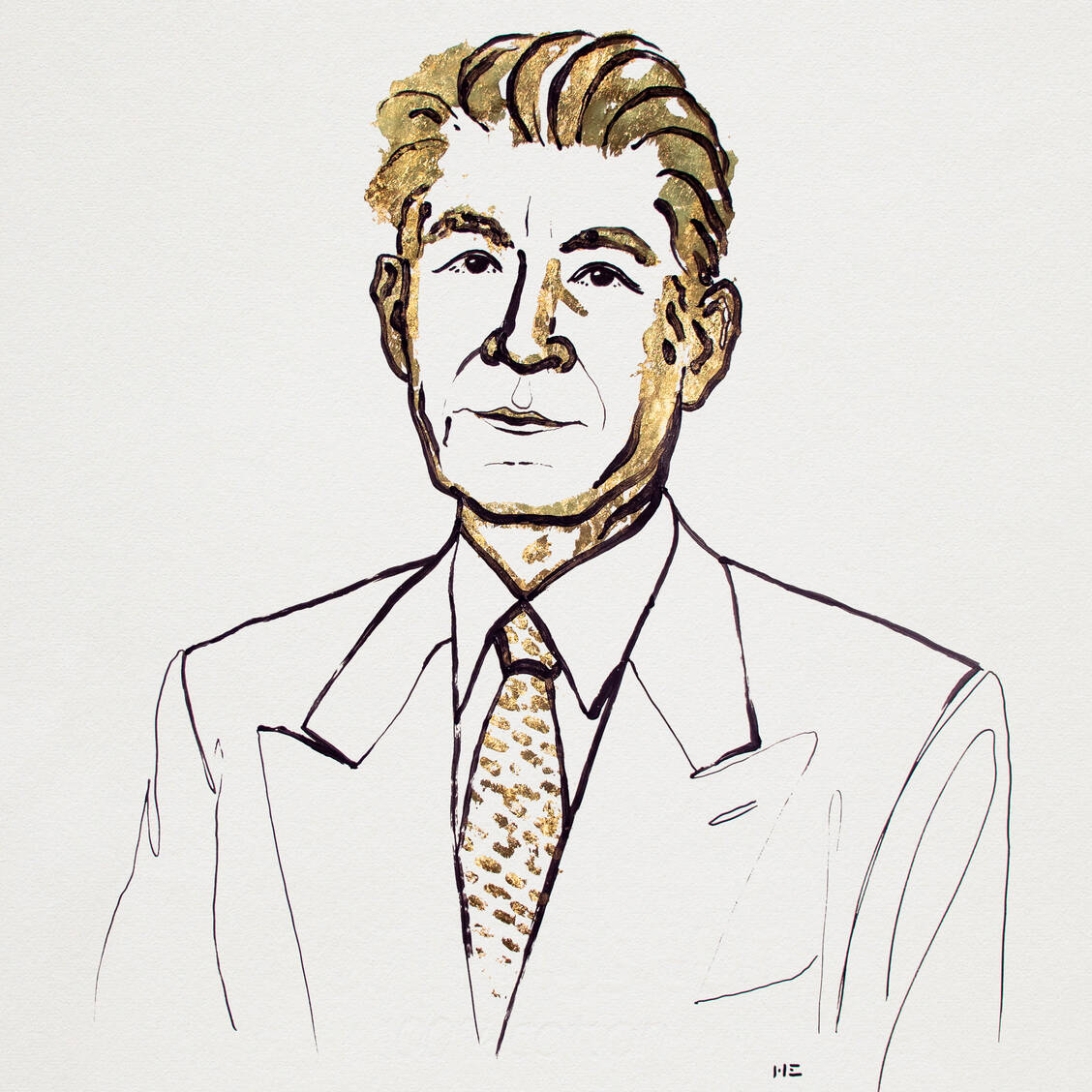
Tasuku Honjo wurde gemeinsam mit James Allison 2018 den Nobelpreis für Medizin verliehen. / Foto: Nobel Media AB 2018/Niklas Elmehed
Zurück zur Entdeckung des PD-1-Rezeptors: Tasuku Honjo forschte Anfang der neunziger Jahre an der Universität von Kyoto über den programmierten Zelltod (Apoptose) von T-Zellen. Als Apotose wird der gesteuerte Selbstmord von Zellen bezeichnet, der dazu dient, defekte, überaktive oder in anderer Hinsicht schädliche Zellen aus dem Verkehr zu ziehen. Bei seinen Forschungsarbeiten stieß Honjo auf das PD-1-Gen, das bei der Vermeidung von Autoimmunreaktionen eine wichtige Rolle spielt. Durch Bindung des Liganden PD-L1 an den PD-1-Rezeptor wird der programmierte Zelltod von T-Zellen ausgelöst. Antigen-präsentierende Zellen – ein Spezialtrupp des Immunsystems, der potenziell gefährliche Zellen erkennt – produzieren diesen Liganden, um eine überschießende Aktivität zytotoxischer T-Zellen zu verhindern. Und genauso machen es manche Krebszellen: Sie setzen PD-L1 frei und bringen die T-Zellen mit diesem Signal dazu, sich umzubringen anstatt Jagd auf die Krebszellen zu machen. Perfider geht es kaum.
Inzwischen sind bereits mehrere Checkpoint-Inhibitoren auf dem Markt, die sich gegen den PD-1-Rezeptor oder seinen Liganden richten. Der erste PD-1-Inhibitor, der 2014 in den USA und ein Jahr später in Europa zugelassen wurde, ist Nivolumab (Opdivo®). Die Zulassung erfolgte zunächst für das fortgeschrittene Melanom, aber dann ging es Schlag auf Schlag: Mittlerweile ist Nivolumab in Deutschland außerdem zugelassen für das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC), das Nierenzellkarzinom, das klassische Hodgkin-Lymphom, Plattenepithelkarzinome des Kopf-Hals-Bereichs sowie das Urothelkarzinom.
In der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie CheckMate-066, einer randomisierten Doppelblind-Studie, wurde Nivolumab bei insgesamt 418 Patienten mit fortgeschrittenem, aber noch unbehandeltem Melanom vom BRAF-Wildtyp im Stadium III oder IV geprüft. Sie wurden entweder mit Nivolumab oder Dacarbazin behandelt. Die Überlegenheit der innovativen Therapie war beeindruckend: Die Ein-Jahres-Überlebensrate betrug unter Nivolumab 73 Prozent im Vergleich zu 42 Prozent unter Dacarbazin. Das mediane progressionsfreie Überleben war unter Nivolumab mit 5,1 Monaten signifikant länger (Dacarbazin: 2,2 Monate). Und der Anteil von Patienten mit kompletter oder partieller Remission betrug 40 Prozent unter Nivolumab gegenüber 14 Prozent unter Dacarbazin.