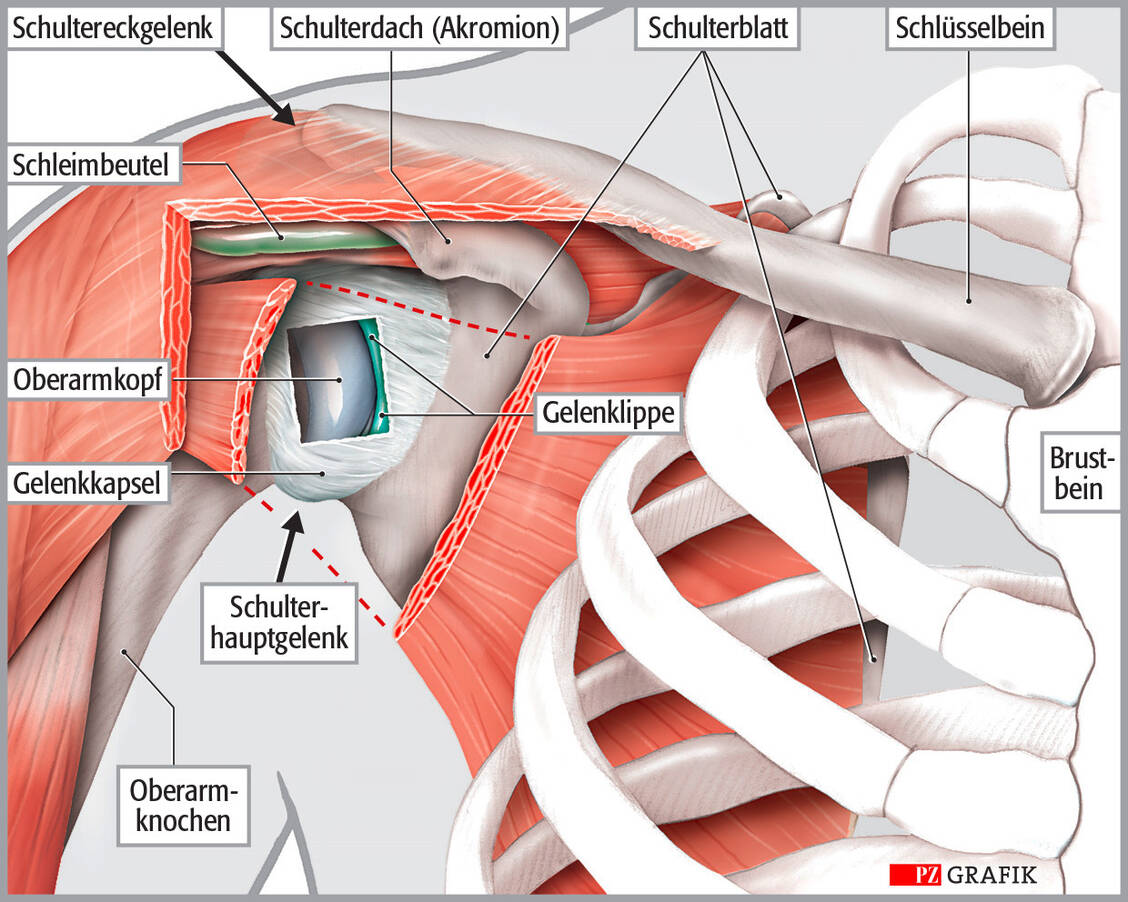Die Schultersteife verläuft in drei Phasen: Zu Beginn der Erkrankung sind Schmerzen das dominierende Symptom. Sie werden als dumpf und tiefliegend beschrieben, mitunter strahlen sie bis in den Bizeps aus. Da sie anfangs gut auszuhalten sind, messen die meisten Betroffenen ihnen zunächst nur wenig Bedeutung zu. Über Monate hinweg kommt es jedoch zu einer deutlichen Verstärkung der Schmerzen, bis diese auch in Ruhe und vor allem nachts auftreten. Das erleben Betroffene nun als große Belastung: Der Schlaf wird empfindlich gestört und Liegen auf der betroffenen Seite ist unmöglich, da es die Beschwerden zusätzlich verstärkt.