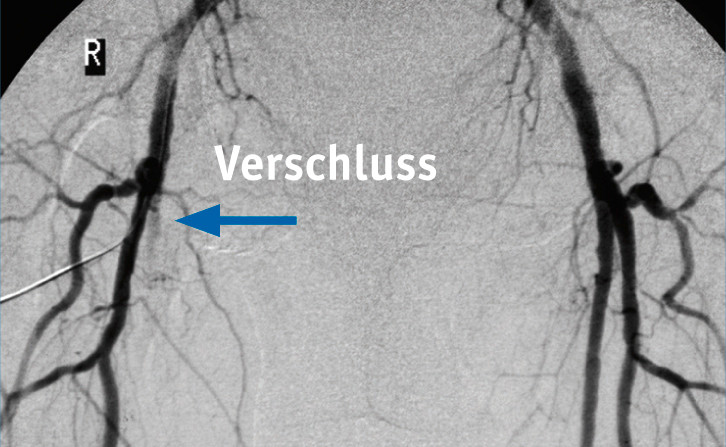Eigentlich ist es logisch: Eine Arteriosklerose ist ein Phänomen, das sich in allen Gefäßen des Organismus von Kopf bis Fuß zeigt. So ist es wenig verwunderlich, dass in der Regel bei PAVK-Patienten nicht nur die Arterien der Beine verengt sind, sondern gleichzeitig auch die herz- und hirnversorgenden Schlagadern. »Tatsächlich gibt es eine sehr hohe Kreuzmorbidität. 40 bis 50 Prozent der PAVK-Patienten haben eine relevante koronare Herzerkrankung, also relevante Ablagerungen in den Arterien am Herzen, 10 bis 20 Prozent der Betroffenen haben Stenosen und Verschlussprozesse der Gehirngefäße, der Halsschlagader und der intrakraniellen Gefäße«, bestätigt der Gefäßspezialist. Herzinfarkt, Schlaganfall und PAVK sind lediglich unterschiedliche Manifestationsformen ein und derselben Erkrankung, heißt es denn auch in der PAVK-S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Angiologie, Gesellschaft für Gefäßmedizin (DGA).